![]()
Stuttgarter Sehenswürdigkeiten Cache
von TrackCop
 Deutschland > Baden-Württemberg > Stuttgart, Stadtkreis
Deutschland > Baden-Württemberg > Stuttgart, Stadtkreis
Achtung! Dieser Geocache ist „archiviert“! Es befindet sich kein Behälter an den angegebenen (oder zu ermittelnden) Koordinaten. Im Interesse des Ortes sollte von einer Suche unbedingt abgesehen werden!
|
|
||||
|
|||||
| Listing |

|
![]() Beschreibung
Beschreibung
Die idyllische Lage brachte Stuttgart den Ruf, eine der sieben schönsten Städte der Welt zu sein; so schrieb schon der berühmte Gelehrte und Weltreisende Alexander von Humboldt. Laut der Zeitschrift Focus 50/2000 hat Stuttgart die höchste Lebensqualität in Deutschland unter allen Großstädten. Stuttgart ist die Landeshauptstadt Baden-Württembergs und zugleich die Kernstadt einer Region mit 3 Millionen Einwohnern. Sie zählt zu den reichsten Städten Europas und ist Deutschlands reichste Großstadt. Wer zum ersten Mal unsere schöne Landeshauptstadt besucht, der mag durch die Stadt gehen, über die Königstrasse flanieren und sich auf dem Schlossplatz auf einer Parkbank niederlassen. Aber es gibt noch viel mehr zu sehen und zu bestaunen.
Der Stuttgarter Sehenswürdigkeiten Cache führt dich zu verschiedenen Punkten Stuttgarts. Den geschichtlichen und aktuellen Hintergrund zu den einzelnen Punkten, kannst du hier in der Cachebeschreibung nachlesen. Die Koordinaten führen dich jeweils zu Erklärungstafeln, die an den Sehenswürdigkeiten angebracht sind. An den einzelnen Stationen muss ein Buchstabe oder eine bestimmte Zahl notiert werden.
Zusammengesetzt ergeben diese Buchstaben dann ein Lösungswort. Die Verwendung der Zahlen erfährst du im Final.
Es handelt sich um einen sehr umfangreichen Cache, der kreuz und quer durch Stuttgart führt. Insbesondere mit Kindern oder wenn man die einzelnen Sehenswürdigkeiten intensiver besichtigen will, ist der Cache eventuell nicht an einem Tag zu schaffen. Aus diesem Grund habe ich mich auch für die hohe Terrainwertung entschieden, obwohl es sich bei allen Wegen um gut ausgebaute, asphaltierte Wege handelt, so dass der Cache auch mit dem Kinderwagen/Fahrrad/Rollstuhl gemacht werden kann. Aufgrund der zurückzulegenden Strecken empfiehlt es sich den Cache mit dem Auto zu machen. Man kann zwar nicht überall unmittelbar anfahren, aber auch dort wo man direkt anfahren kann, muss man auf jeden Fall kurz aussteigen, um an den angegebenen Koordinaten nach dem Lösungsbuchstaben zu sehen. Für die Innenstadtstages bietet es sich an, das Auto in einem der zahlreichen Innenstadtparkhäuser zu parken. Am besten für unsere Zwecke geeignet ist das Parkhaus an den Koordinaten N 48°46.586', E 9°10.772'
Selbstverständlich können aber auch alle Sehenswürdigkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln angefahren werden. Hierfür ist jedoch einiges mehr an Zeit einzuplanen. Fahrplanauskünfte und Linienpläne gibt es unter www.ssb-ag.de und www.vvs.de/plaene.php
Begebe Dich zu folgendem Startpunkt.
-
Schillerplatz
N 48° 46,626´ E 9° 10,711´
Auf dem Boden des Sockels ist eine Metallplatte eingelassen. Notiere Dir den 2. Buchstaben der 3. Zeile als 13. Buchstaben des Lösungswortes.
Parkplatz: 48°46.586', E 9°10.772'
ÖPNV: U5, U6, U7, 15 Haltestelle Schlossplatz
Achtung:
Während dem Stuttgarter Weindorf und dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist dieser Punkt zugebaut und nicht erreichbar. Allerdings ist diese Stage für die Lösung auch nicht absolut erforderlich. Mit ein wenig Kombinationsgabe bekommt man das Lösungswort auch so heraus.
Weindorf und Weihnachtsmarkt sind jedoch auch eine Sehenswürdigkeit für sich, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Die Termine erfahrt ihr hier:
Stiftskirche, Fruchtkasten, Altes Schloss und die Alte
Kanzlei begrenzen den Schillerplatz, von dem man einst sagte, er
sei einer der schönsten Plätze Europas. Im Mittelpunkt des durchweg
gepflasterten Platzes steht das Schillerdenkmal, das von dem Dänen
Berthel Thorvaldsen erschaffen wurde (1839).
Bemerkenswert: Es war das erste Schillerdenkmal Deutschlands
überhaupt. Heute finden auf dem Schillerplatz der Wochenmarkt, der
große Weihnachtsmarkt, das bekannte Stuttgarter Weindorf sowie
zahlreiche weitere Veranstaltungen statt.
In der südwestlichen Ecke befindet sich der Fruchtkasten. Der spätgotische Steinbau mit seinem spitzen Giebel liegt an der Südwestecke des Schillerplatzes gegenüber dem Alten Schloss. In früheren Zeiten diente der Fruchtkasten als Kornspeicher und als Kelter (ehemals Zehntscheune des Chorherrenstifts Stuttgart). Im Jahre 1596 gestaltete der Baumeister Heinrich Schickardt das Steingebäude neu. Knapp 360 Jahre später, 1954 bis 1956, wurde der Fruchtkasten restauriert. Heute befinden sich in dem Steingebäude die Musikinstrumentensammlung des Württembergischen Landesmuseums.
Die im 16. Jahrhundert erbaute Alte Kanzlei befindet sich an der Nordostseite des Stuttgarter Schillerplatzes. Für den Herzog war die Alte Kanzlei ein wichtiges Gebäude für seinen Herrschaftsbereich. In ihr waren die Landschreiberei mit Registratur, die Buchhaltung, die Hofkammer sowie die Vorratskammern für das benachbarte Alte Schloss, Wohnsitz des Herzogs, untergebracht. Neuzeitlich könnte man die Alte Kanzlei mit dem heutigen Rathaus vergleichen. Der Bau des mächtigen Monuments dauerte drei Jahre von 1542 - 1544. Nur 22 Jahre später, im Jahre 1566, wurde der Bau der Alten Kanzlei erweitert. Heute wird das Gebäude gastronomisch genutzt. Restaurant, Café und Bar "Alte Kanzlei" laden zum Verweilen ein. (Anm. d. Owners: die Preise sind allerdings nicht gastronomisch, sondern astronomisch.)
© Landeshauptstadt Stuttgart
An der Westseite des Platzes befindet sich der Prinzenbau. Einen Hauch von Italien bringt der Prinzenbau mit seiner palladianischen Fassade nach Stuttgart. Früher war das 1605 von Heinrich Schickhardt begonnene und 1715 von Friedrich Nette vollendete Palais unter anderem Wohnsitz der württembergischen Prinzen. Im Jahr 1848 wurde hier Württembergs letzter Monarch König Wilhelm II geboren. Heute ist im Prinzenbau ein Teil des Justizministeriums untergebracht
-
Stiftskirche
N 48° 46,597´ E 9° 10,647´
Auf der Tafel die unterste Jahreszahl = A
"Stuttgart hat seine Stiftskirche wieder", titelten die Medien bei der Wiedereröffnung der größten und ältesten Kirche im Herzen der Landeshauptstadt am 13. Juli 2003. Nach vier Jahren Bauzeit können sich die Besucher nun an den vielfach erstmals gezeigten Kunstwerken der Gotik freuen und staunend den Blick in die kühne Deckenkonstruktion richten. Die neue Decke mit abgehängten Glassegeln streckt und vertikalisiert den Raum. Die Kirchenfenster gestaltete der Künstler Professor Hans Gottfried von Stockhausen neu. Bei der Renovierung stieß man auf bedeutende Ausgrabungen: Gräber unter dem seitherigen Kirchenboden. Archäologen förderten erstmals Belege dafür zu Tage, dass es eine Besiedlung lange vor der um 950 datierten Anlage des Stutengartens gab. Zwei alemannische Gräber weisen in das siebte oder achte Jahrhundert.
Die Renovierungsarbeiten in Höhe von rund 13,6 Millionen Euro wurden mit 2,7 Millionen von Stadt, Land und Denkmalstiftung unterstützt, mit rund 3 Millionen Spendengeldern und 7,9 Millionen Euro Kirchenmitteln finanziert. Bereits um 1175 wird der Vorgängerbau der Stiftskirche, eine romanische Kirche erwähnt. Ihren Namen verdankt sie Graf Ulrich I., der ca. 1240 den Bau "stiftete". Zu dieser Zeit wurde die einschiffige Dorfkirche zu einer spätromanischen dreischiffigen Basilika umgebaut. Die württembergischen Grafen und Familien fanden dort ihre letzte Ruhestätte. Unter Chor und Sakristei befinden sich räumlich getrennte Grabkammern.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Markthalle
N 48° 46,550´ E 9° 10,769´
Von wie viel Uhr an ist die Markthalle immer geöffnet?
5 Uhr = T
6 Uhr = E
7 Uhr = M
8 Uhr = P
Notiere Dir den richtigen Buchstaben als den 9. Buchstaben des Lösungswortes.
Wer die schweren Pforten der Stuttgarter Markthalle öffnet, taucht ein in eine Atmosphäre aus orientalischem Basar und regionalem Marktgeschehen: Multikulturelles Stimmengewirr zwischen Marktständen, der Duft nach Gewürzen, frisches Obst und Gemüse. Die im Jugendstil erbaute Markthalle gilt als eine der schönsten auf der Welt. Auf über 3500 Quadratmetern können die Kunden täglich frische Blumen, Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst sowie exotische Früchte und Gewürze kaufen.
Von der Galerie im ersten Stock bietet sich dem Besucher ein Blick auf das bunte Treiben. Hier befindet sich das Warenhaus "Merz und Benzing", in dem unter anderem Einrichtungsgegenstände von hoher Designqualität, Wohn- und Gartenaccessoires, exquisite Kosmetikartikel und erlesene Literatur angeboten werden. Nach einem ausgiebigen Bummel bieten die drei gastronomischen Bereiche der Markthalle feine Speisen und Getränke.
Der Architekt Martin Elsaesser erbaute die Markthalle in den Jahren 1912 bis 1914. Sie ersetzte die alte Gemüsehalle, die der König von Württemberg 1864 an gleicher Stelle errichtet hatte. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Markthalle zerstört und wurde wieder aufgebaut. 1953 war sie vollständig wieder hergestellt. 20 Jahre späte wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Nach einem Brand 1993 musste der gesamte Innenraum der Markthalle renoviert werden.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Rathaus
N 48° 46,490´ E 9° 10,701´
Jahr der Einweihung = B
Das Stuttgarter Rathaus ist das dritte im Laufe
der Stadtgeschichte.
Von dem neugotischen Vorgänger des heutigen Gebäudes steht nur
noch der hintere Anbau, welcher 1899 – 1905 von Heinrich
Jassoy und Johannes Vollmer erbaut wurde.
Das heutige Gebäude entstand nach Plänen von Schmohl und
Stohrer.
Vom Glockenspiel auf dem modernen 60,50 m
hohen Rathausturm erklingen mehrmals täglich
schwäbische Volkslieder.
Spielzeiten: 11.06 Uhr, 12.06 Uhr, 14.36 Uhr und 18.36. Uhr
-
Schellenturm im Bohnenviertel
N 48° 46,388´ E 9° 11,020´
Notiere dir den 1. Buchstaben der 1. Zeile als 1. Buchstaben des Lösungswortes.
Das Bohnenviertel entstand als erstes Wohnquartier im 15. Jahrhundert außerhalb der Stadtmauer. Hier siedelten sich vor allem Handwerker, Weinbauern, Kleinhändler und Pfandleiher an. Seinen Namen erhielt das Viertel wegen der Armut seiner Bewohner: Sie pflanzten in ihren Gärten Bohnen an und hängten diese später zum Trocknen an ihren Häusern auf. Die ältesten Gebäude im Bohnenviertel stammen aus dem 15. Jahrhundert. Der Schellenturm von 1564 ist alles, was von der historischen Stadtmauer übrig blieb. Seinen Namen verdankt er den Metallfesseln, den sogenannten „Schellen“, mit denen früher Sträflinge im Innern festgekettet waren. Heute präsentiert sich das Bohnenviertel in liebevoll renoviertem Gewand. Die vielen kleinen Antiquitäten- und Trödelläden laden zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Und in den gemütlichen Kneipen, Cafés und Weinstuben lässt es sich herrlich entspannen.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Landtag
N 48° 46,764´ E 9° 11,029´
Notiere Dir den 1. Buchstaben der 1. Zeile als 16. Buchstaben des Lösungswortes
Der Sitz des baden-württembergischen Landtages befindet sich
seit 1961 in unmittelbarer Nachbarschaft zu Neuem Schloss und
Staatstheater. Das dreistöckige Gebäude mit seiner dunklen
Fassadenverglasung bildet einen interessanten architektonischen
Kontrast zu den historischen Gebäuden Stuttgarts. Der kubische
Stahlskelettbau auf Pfeilern wurde von Erwin Heinle und Horst Linde
nach Entwürfen von Kurt Viertel errichtet (1959-1961).
In den 60er Jahren erregte das außergewöhnliche Haus als
hochmoderner Zweckbau viel Aufsehen - auch als politisches Symbol:
Der transparente Blick bei Dämmerung in die Büros der Abgeordneten
galt als Sinnbild für die junge Demokratie. Sehenswert im
Erdgeschoss ist eine Fossilienwand aus der Jurazeit.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Staatstheater
N 48° 46,773´ E 9° 11,037´
Differenz der Jahreszahlen = C (positives Ergebnis)
Das Staatstheater Stuttgart ist das größte Drei-Sparten-Theater
der Welt mit Oper, Ballett und Schauspiel. Die renommierte
Staatsoper Stuttgarts und das international berühmte Stuttgarter
Ballett agieren im Großen Haus (Opernhaus), während im
Schauspielhaus (Kleines Haus) Theateraufführungen stattfinden. Das
ehemalige Königliche Hoftheater wurde Anfang des 20. Jahrhunderts
von dem Münchner Architekten Max Littmann als Doppeltheater mit
Oper- und Schauspielhaus erbaut.
1924 wurden die Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Erhalten
blieb nach dem Zweiten Weltkrieg nur das mit klassizistischen
Säulen geschmückte Große Haus. Die Königsloge, schwere
Kronleuchter, die kassierten Decken und die Marmorbüsten im Innern,
bieten dem Betrachter ein prunkvolles und zugleich edles Bild. Das
Große Haus hat rund 1400 Plätze und ist bereits fünf Mal als "Oper
des Jahres" ausgezeichnet worden, der Staatsopernchor Stuttgart
erhielt fünf Mal in Folge die Auszeichnung "Chor des Jahres". Das
frühere Kleine Haus wurde 1962 durch einen Neubau aus Beton, Stahl
und Glas ersetzt. Die Architekten Volart, Pläcking und Perla
planten den modernen Bau.
Das Schauspielhaus bietet 851 Zuschauern Platz. In dem
interessanten Gebäude direkt im Schlossgarten finden auch andere
kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen statt. Die Geschichte vom
Ballett in Stuttgart reicht weit bis ins 17. Jahrhundert zurück.
Gastspiele ausländischer Ballett-compagnien aus Paris, London,
Russland und New York entfachten erneut das öffentliche Interesse
für klassischen Tanz nach 1945. Namhafte Ballettdirektoren wie
Nicolas Beriozoff (1957), John Cranko (1961), Glen Tetley (1974),
Marcia Haydée (1976) und Reid Anderson (1996) prägten den Weltruf
des Stuttgarter Balletts signifikant. Das Stuttgarter Ballett ist
heute bei rund 100 Vorstellungen im Jahr. Im November 2001 feierte
es sein 40. Jubiläum.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Neues Schloss und Schlossplatz
N 48° 46,723´ E 9° 10,857´
Notiere Dir den 8. Buchstaben des 3. Wortes der letzten Zeile als 6. Buchstaben des Lösungswortes.
Imposant steht das Neue Schloss im Herzen der
Landeshauptstadt Stuttgart. Der Spätbarockbau, eines der letzten
großen Stadtschlösser Süddeutschlands, erinnert an die
französischen Vorbilder des 17. Jahrhunderts.
Herzog Karl Eugen war es, der die dreiflügelige Anlage in Anlehnung
an das berühmte Schloss von Versailles von den Architekten Nikolaus
Friedrich Thouret, Leopoldo Retti und Philippe da la Goepière sowie
R.F.H. Fischer errichten ließ (1746 bis 1807).
Die Residenz der baden-württembergischen Könige wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und später wieder aufgebaut. Heute sind im Neuen Schloss Finanz- und Kultusministerium untergebracht, darüber hinaus nutzt es die Landesregierung für Repräsentationszwecke.
Das Neue Schloss knüpft direkt an den Schlossplatz an. Die
barocke Gartenanlage mit Brunnen, Musik-Pavillon und Jubiläumssäule
gehört zu einem der Hauptplätze der Stadt. Die 30 Meter hohe
Jubiläumssäule aus dem Jahr 1841, die von der 100 Zentner schweren
Göttin Concordia gekrönt ist, bildet das Zentrum des
Schlossplatzes.
Der 1977 anlässlich der Bundesgartenschau umgestaltete Platz gibt
den Blick frei auf wunderschön symmetrisch und großzügig angelegte
bunte Blumenarrangements.
Der Schlossplatz mit Sicht auf das barocke Neue Schloss, den
spätklassizistischen Königsbau, die mittelalterliche Alte Kanzlei
und das Alte Schloss im Renaissance-Stil rundet dieses historische
Gesamtkunstwerk ab. Der ehemalige Paradeplatz ist heute Ort für
Open-Air-Veranstaltungen aller Art wie hochkarätige Pop-Konzerte
und illustre Stadtfeste.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Königsbau
N 48° 46,731´ E 9° 10,702´
Wie lautet das Endjahr an dem der Königsbau errichtet wurde? = D (4-stellig)
Der Königsbau, Mitte des 19. Jahrhunderts im spätklassizistischen Stil errichtet, bildet die westliche Abgrenzung des Schlossplatzes. Im Krieg zerstört, wurde das ehemalige Geschäftshaus1958/59 wieder aufgebaut. Die imposante Kolonnade aus 34 Säulen hat eine Länge von 135 Metern und prägt das gesamte Gebäude. Früher fanden dort prunkvolle Hoffeiern statt, heute laden Cafés und Einkaufspassagen zum Bummeln ein.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Altes Schloss
N 48° 46,646´ E 9° 10,770´
Notiere Dir den 3. Buchstaben der 2. Zeile als 11. Buchstaben des Lösungswortes.
Das Alte Schloss ist neben der benachbarten Stiftskirche das älteste erhalten gebliebene Bauwerk der Stadt. Teile der Grundmauern gehen bis auf das 10. Jahrhundert zurück, wo es um 941 als einfache Wasserburg entstanden ist. In seiner wechselvollen Geschichte wurde es mehrfach umgebaut, ergänzt, häufig belagert und in Kriegen zerstört. Im 16. Jahrhundert entstand aus der Burganlage ein Renaissanceschloss. Unter den schweren Luftangriffen auf Stuttgart im Sommer 1944 sank es zum Großteil in Schutt und Asche. Das Alte Schloss, tiefes Symbol der württembergischen Landesgeschichte, wurde bis 1969 wiederaufgebaut. Seit 1948 ist im Alten Schloss das Württembergische Landesmuseum untergebracht - ein Geschichtsmuseum höchsten Rangs für das Land. Die dazugehörige Schlosskapelle, die Mitte des 16. Jahrhunderts entstand, gehört zu den ältesten protestantischen Kulträumen Süddeutschlands. Bis heute gibt sie eine herrliche Kulisse für sommerliche Abendkonzerte ab.
© Landeshauptstadt Stuttgart
Ab hier müssen entweder das Auto oder öffentliche Verkehrsmittel bemüht werden.
-
Weißenburgpark mit Teehaus und Marmorsaal
N 48° 45,863´ E 9° 10,948´
Wieviele Säulen umranden das Teehaus?
Anzahl = E
Parkplatz: N 48° 45,935´ E 9° 11,015´
ÖPNV: U5, U6, U7 Haltestelle Bopser
Hoch über der Landeshauptstadt, verborgen unter alten Bäumen lädt der kleine Pavillon des Teehauses mit seinen Marmorsäulen und einer großen Gartenterrasse zum Verweilen ein. Das Teehaus wurde zusammen mit dem Marmorsaal im Jahre 1913 im Auftrag des Industriellen und Antikenforschers Ernst von Sieglin von dem Stuttgarter Architekten Heinricht Henes im Park der Villa Weißenburg gebaut. 1989 wurden Teehaus und Marmorsaal nach längerem Dornröschenschlaf restauriert, die klassizistische Villa Weißenburg hatten die Stadtväter 1964 abreißen lassen. Heute können sich die Gäste im Schatten der Bäume vom Bedienungspersonal verwöhnen lassen. Lohnenswert ist auch ein Besuch der Aussichtsplattform über der Terrasse mit Blick über die Dächer von Stuttgart.
Anm. des Owners:
Für diejenigen, die sich bis hierher einen Durst „angelaufen“ haben, bietet sich hier eine sehr schöne Möglichkeit für eine Rast an. Unterhalb des Aussichtspunktes befindet sich auch ein größerer Kinderspielplatz.
Sehr sehenswert ist auch die Deckenmalerei im Inneren des Teehauses, die galante Szenen im Rokoko-Stil zeigt.
-
Fernsehturm
N 48° 45,323´ E 9° 11,365´
Von wieviel Uhr an ist normalerweise die Besucherplattform täglich geöffnet?
Stundenzahl = F
ÖPNV: U5, U6 bis Haltestelle Albplatz dann Bus Linie 70 bis Haltestelle Fernsehturm
Das Konstruktionsvorbild für die Fernsehtürme in aller Welt (er
ist der 1. Fernsehturm der Welt) hat eine imponierende Höhe von 217
Metern. Er steht auf dem Hohen Bopser (483 m ü.d.M.). Seit über 40
Jahren ist er das Wahrzeichen von Stuttgart. Nach einer Bauzeit von
nur 20 Monaten gab die Fernsehturm-Betriebs GmbH am 5. Februar 1956
den Fernsehturm für die Öffentlichkeit frei.
Die Konstruktion des Stuttgarter Ingenieurs Prof. Dr. Fritz
Leonhardt und die unterstützende Mitarbeit des Oberbauleiters Prof.
Erwin Heinle ließen dieses Meisterwerk schwäbischer Baukunst
entstehen. Die Baukosten in Höhe von 4,2 Millionen Mark wurden
bereits nach nur fünf Jahren durch die Eintrittsgelder amortisiert.
Der Ausblick über die Stadt bis hin zum Schwarzwald und der
Schwäbischen Alb ist phänomenal. Bei gutem Wetter kann man sogar
die Alpen sehen!
© Landeshauptstadt Stuttgart
Anm. d. Owners:
Auch wenn der eine oder andere Durst haben sollte, so rate ich dennoch dringend von dem Besuch der Gaststätte unter dem Fernsehturm ab. Das Personal ist äußerst unfreundlich und wird manchmal sogar aggressiv und beleidigend (selbst erlebt).
-
Zahnradbahn
N 48° 45,006´ E 9° 10,314´
Die gesuchte Tafel trägt die Überschrift „Die Geschichte der Zahnradbahn Stuttgart - Degerloch“
Notiere Dir auf der Seite die am längsten zurückliegende Jahreszahl = G
ÖPNV: U10, Buslinie 70 Haltestelle Zahnradbahnhof
Die gerade Verbindung ist
bekanntlich die kürzeste. In Stuttgart heißt das, extreme
Steigungen zu überwinden. Vom Marienplatz nach Degerloch klettert
seit 1884 die Zahnradbahn, auch Zacke genannt, auf der bis zu 170
Promille steilen Strecke nach oben - mit den prächtigsten
Stuttgart-Panoramablicken. Und weil auch Radfahrer gerne den
SSB-Service nutzen, können sie ihren Drahtesel dem speziellen
Fahrradwagen anvertrauen. Die Stuttgarter Zacke ist übrigens die
einzige Zahnradbahn Deutschlands, die vor allem dem ganz normalen
täglichen Berufsverkehr einer Großstadt dient.
Der Fahrzeugbestand der Zacke besteht aus drei vierachsigen
Zahnradtriebwagen der Bauart ZT 4 (Baujahr 1982), wobei planmäßig
immer zwei Wagen im Einsatz stehen und fast ganzjährig jeweils eine
der drei Fahrradloren mitführen.
Von der Fahrzeug-Vorgängergeneration von 1928 bzw. 1898 (Triebwagen
und Vorstellwagen) steht ein kompletter Zug im Straßenbahnmuseum
Stuttgart-Zuffenhausen (www.shb-ev.de).
Streckenlänge: 2,2 km
Spurweite: 1000 mm
Höhenunterschied Marienplatz - Degerloch: 210 m
Maximale Neigung: 17,8 Prozent (Betriebsgleis zum Depot
Filderstraße: 20 Prozent)
Eröffnung: 25.08.1884 (Stuttgart Zahnradbahnhof Filderstraße -
Degerloch Zahnradbahnhof)
21.12.1936: Abzweig Liststraße - Marienplatz
16.12.1994: Degerloch Zahnradbahnhof - Degerloch (0,2 km)
-
Seilbahn
N 48° 45,356´ E 9° 08,528´
Die gesuchte Tafel trägt die Überschrift „Zur Geschichte der Stuttgarter Standseilbahn“
Notiere Dir aus der 4. Zeile der 1. Spalte den 3. Buchstaben als 3. Buchstaben des Lösungswortes.
ÖPNV: U1, U14 Haltestelle Südheimer Platz
Erbschleicherexpress sagen die einen, Lustige-Witwen-Bahn heißen
sie die anderen. Wie dem auch sei: Die beschauliche Standseilbahn
im Stadtteil Heslach, die den Besucher zum Waldfriedhof bringt, ist
ein liebenswertes Überbleibsel aus der Vergangenheit. An jedem Ende
des 550 Meter langen Stahlseiles hängt ein heimeliger rotbrauner
Wagen. Fast geräuschlos gleitet einer auf den blanken Schienen
aufwärts, der andere kommt entgegen - oder umgekehrt. Viel
Teakholz, Messing und Emaille versetzen den Benutzer auf der mit
bis zu 28 Prozent geneigten Strecke in die Zeit der 1920er Jahre.
Ehrensache, dass der SSB die Erhaltung dieses lebenden Stückes
Stadtgeschichte am Herzen liegt. Deshalb ist sie 2003/2004
technisch saniert worden; äußerlich merkt man es ihr die Moderne
aber nicht an.
Denn die Stuttgarter Seilbahn präsentiert sich fast komplett als
originales Ensemble im Zustand des Eröffnungsjahres 1929 und steht
unter Denkmalschutz. Sie war schon damals die erste Standseilbahn
Deutschlands mit automatischer Steuerung (auf Knopfdruck durch den
Wagenbegleiter), und die schnellste. Und seither läuft sie wie am
Schnürchen.
Streckenlänge: 536 m
Spurweite: 1000 mm
Höhenunterschied: 87 m
Größte Neigung: 28,2 o/o
Eröffnung: 30.10.1929
Als Zusatzattraktion ist es nach einer kurzen Bergfahrt mit der Seilbahn noch möglich in dem sehr schönen Waldgebiet rund um den Waldfriedhof den Geburtstagscache für Roadster2000 zu suchen.
-
Schloss Solitude
N 48° 47,203´ E 9° 05,049´
Von dieser Position begibst Du Dich 20 Meter in Richtung 030°
Hier ist eine Tafel in den Boden eingelassen.
Notiere Dir den 2. Buchstaben der 3.-letzten Zeile als 15. Buchstaben des Lösungswortes.
Parkplatz: N 48° 47,256´ E 9° 05,128´
ÖPNV: Buslinie 92 Haltestelle Solitude
Das ehemalige Lustschloss von Herzog Carl Eugen wurde 1763
bis 1767 erbaut. Es liegt westlich von Stuttgart auf einer
bewaldeten Anhöhe und bietet den Besuchern einen herrlichen
Ausblick. Architekten waren Philippe des la Guepière, R.F.H.
Fischer, J.J. Weyhing sowie Nikolaus Friedrich von Thouret, der den
Innenausbau übernahm.
Die offene Dreiflügel-Anlage erinnert noch heute an die prunkvollen
alten Zeiten, da sowohl das Enterieur als auch einzelne Möbelstücke
im Original erhalten sind. Bemerkenswert in diesen elf Räumen ist
der Wechsel zwischen Rokoko und Klassizismus. In der Umbruchphase
von einer zur anderen Epoche war es ganz selbstverständlich, beide
Stile nebeneinader stehen zu lassen. Das begehrte Ausflugsziel
mit Schloss-Restaurant beheimatet heute eine Akademie für junge
Künstler, die der Förderung dient.
Nur fünf Kilometer entfernt liegt die legendäre Solitude-Rennstrecke, auf der bis 1962 F1-Rennen gefahren wurden. Im Jahre 2003 feierte das Solitude-Rennen sein 100jähriges Jubiläum.
© Landeshauptstadt Stuttgart
Als Zusatzattraktion ist es an Schloss Solitude noch möglich nach folgenden Caches zu suchen:
Solitude Cache Stuttgart (Mystery Cache)
-
Birkenkopf
N 48° 45,932´ E 9° 07,884´
Notiere Dir den 1. Buchstaben der 2. Zeile als 8. Buchstaben des Lösungswortes.
Parkplatz: N 48° 45,899´ E 9° 08,109´
ÖPNV: Buslinie 92 Haltestelle Birkenkopf
Einen eindrucksvollen Blick über den Stuttgarter Talkessel und
die gesamte Umgebung hat man von Stuttgarts zweithöchstem Hügel,
dem 511 Meter hohen Birkenkopf. Von den Stuttgartern auch "Monte
Scherbelino" genannt, da der Hügel nach dem Zweiten Weltkrieg mit
dem 15.000.000 m³ Trümmerschutt aus der fast zur Hälfte zerstörten
Stadt um mehr als 40 Meter aufgeschüttet wurde, ist der Birkenkopf
heute ein beliebtes Ausflugsziel. Unter dem Gipfel-Holzkreuz finden
regelmäßig Gottesdienste statt.
Bei schönem Wetter und guter Sicht reicht der beeindruckende 360
Grad-Rundumblick von den Löwensteiner Bergen bis zur Burg
Hohenzollern. Der Blick nach Osten geht hinunter bis zum Neckar, in
südlicher Richtung erstreckt sich der Blick über Stuttgarts
Waldgebiete bis zur Schwäbischen Alb.
Bei N 48° 45,877´ E 9° 08,060´ erhältst Du interessante Informationen über die geologische Beschaffenheit dieser Stelle.
Als Zusatzattraktion ist es auf dem Birkenkopf noch möglich den Traditional Cache Rubbel-Hill zu suchen.
-
Bismarckturm
N 48° 47,623´ E 9° 09,683´
Notiere Dir aus der 3. Zeile des 3. Absatzes den 1. Buchstaben als 4. Buchstaben des Lösungswortes.
ÖPNV: Buslinie 43 Haltestelle Am Bismarckturm
Zu Ehren des Staatsmannes Bismarck im Jahre 1904 von Studenten der damaligen Technischen Hochschule gestiftet, steht der sanierte Turm im Stuttgarter Norden am Rande des Killesbergs. Gedenkfeuer sollten weithin sichtbar an den großen Deutschen erinnern. Der 20 Meter hohe Turm erlaubt eine der schönsten Aussichten über ganz Stuttgart. Mit einem fantastischen Rund-um-Blick wird der Besucher belohnt, der die 91 Treppen im Innern zur Plattform besteigt. Wegen baulicher Mängel war der Bismarckturm lange Zeit gesperrt. Im Juni 2002 war Richtfest, im September des selben Jahres wurde das Monument der Öffentlichkeit frei gegeben. Die Trägerschaft obliegt seitdem dem Bürgerverein Killesberg und Umgebung e.V.
© Landeshauptstadt Stuttgart
Als Zusatzattraktion ist es am Bismarckturm noch möglich den Traditional Cache Aussichtsreich zu suchen.
-
Weißenhofsiedlung
N 48° 48,049´ E 9° 10,627´
In welchem Jahr war die Ausstellung „Die Wohnung“ zu sehen?
Quersumme der Jahreszahl = H
ÖPNV: U7 Haltestelle Killesberg/Messe
Buslinie 44 Haltestelle Kunstakademie
Als Ende der 20-iger Jahre die Musterwohnungen der Weißenhofsiedlung von 16 Architekten aus fünf Nationen fertiggestellt wurden, waren die Stuttgarter skeptisch. Die Kombination aus schmucklos-sachlichen Flachbauten wurde als "Schandfleck" bezeichnet. Die Nazis wollten das "Araberdorf" sogar abreißen. Heute stellt die Siedlung ein einzigartiges Freilichtmuseum der avantgardistischen Baukunst der 20er Jahre dar. Architekten wie Mies van der Rohe, Walter Gropius oder Le Corbusier waren hier zugange. Der Krieg setzte den Wohnungen im Jahr 1944 allerdings schwer zu, ein weiteres tat der anschließende lieblose Wiederaufbau. 1981 begann man schließlich mit der sorgfältigen Sanierung. Heute sind noch 11 der 21 Wohnungen in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten.
Als zusätzliche Attraktion kann man in unmittelbarer Nähe zu dieser Stelle auch noch den Cache Liegestuhl suchen.
-
Schloss Rosenstein
N 48° 48,031´ E 9° 12,330´
Notiere Dir den 1. Buchstaben des 2. Wortes der 1. Zeile als 12. Buchstaben des Lösungswortes.
Parkplatz: 48° 47,821´ E 9° 12,484´
ÖPNV: U14 Haltestelle Wilhelma
Der italienische Baumeister Giovanni Salucci errichtete 1824
bis 1829 das Schloss Rosenstein im gleichnamigen Park. Der
Familiensitz des württembergischen Königs Wilhelm I. und seiner
Frau Großfürstin Katharina von Russland wurde gleich nach Ende des
Ersten Weltkrieges 1919/1920 als Museum eingerichtet.
Das heutige Naturkundemuseum bietet einen Überblick über die
Entwicklungsgeschichte von Tier und Mensch. Anschaulich zeigt die
biologische Ausstellung Tiere und Pflanzen in ihren heimischen
Lebensräumen. Eine Attraktion ist der 13 Meter lange
Seiwal.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Wilhelma
N 48° 48,248´ E 9° 12,493´
Wie viele Kassen gibt es hier? (nur im runden Pavillon !!!!) Anzahl = J
Parkplatz: am besten lässt man das Auto auf dem Parkplatz der vorherigen Station stehen und geht zu Fuß.
Die Wilhelma verdankt ihre Entstehung König Wilhelm I. von
Württemberg, der Mitte des 19. Jahrhunderts den Architekten
Karl-Ludwig Zanth damit beauftragte, im Park von Schloss Rosenstein
einen Lustgarten im maurischen Stil anzulegen. Für die
Öffentlichkeit war der Park nicht zugänglich, erst 1880 ließ der
König die Wilhelma für Besucher öffnen.
In den 1950er-Jahren wurde die im Zweiten Weltkrieg zerstörte
Anlage wieder errichtet und zum zoologisch-botanischen Garten
ausgebaut. Heute ist die Wilhelma mit rund 10.000 Tieren in fast
1.000 Arten einer der artenreichsten Zoos Deutschlands - gezeigt
wird ein Querschnitt durch alle Klimazonen der Erde. Weltberühmt
ist zum Beispiel die Menschenaffenhaltung: Gorillas, Schimpansen
und Orang Utans leben in Familiengruppen mit reichlich Nachwuchs.
Das Jungtieraufzuchthaus dient inzwischen europaweit als
Menschenaffenkinderstube.
Auch zahllose Pflanzen sind in der Wilhelma zu Hause: Etwa 5.000
Arten gibt es in Europas größtem zoologisch-botanischen Garten. Das
botanische Jahr beginnt in der Wilhelma mit der Blüte der
Orchideen, von denen ca. 5.000 Pflanzen gepflegt werden. Kamelien
und Azaleen mit jeweils über 30 Sorten blühen dann als nächstes.
Einmalig ist auch die Blüte in Europas größtem Magnolienhain.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Klösterle
N 48° 48,334´ E 9° 12,775´
Notiere Dir den 1. Buchstaben der 2. Zeile als 10. Buchstaben des Lösungswortes.
Parkplatz: 48° 48,306´ E 9° 12,878´
ÖPNV: U14 Haltestelle Rosensteinbrücke
U1, U2, U13 Haltestelle Wilhelmsplatz
Das Klösterle im Stadtteil Bad Cannstatt wurde 1463 erbaut und ist heute das älteste Wohnhaus Stuttgarts. Hier wirkten bis zur Reformation die Beginen, ein Frauenorden, der als mildtätig galt und ohne Ordensregeln auskam. Das Klösterle ist das einzige Beginenhaus Europas mit integrierter gotischer Kapelle. Es wurde 1983 originalgetreu restauriert. In der Klösterle-Scheuer ist heute das Stadtmuseum untergebracht, das Besucher über die Geschichte des Stadtteils Bad Cannstatt von der Eiszeit bis zur Kurstadt informiert. Das Klösterle wurde mit finanzieller Unterstützung von "Pro Alt Cannstatt" 1983 restauriert.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Grabkapelle
N 48° 46,923´ E 9° 16,096´
Notiere Dir den 2. Buchstaben des 2. Wortes der 2. Zeile als 17. Buchstaben des Lösungswortes.
Parkplatz: 48° 46,896´ E 9° 16,174´
ÖPNV: Buslinie 61, Endhaltestelle Rotenberg
Anm. d. Owners:
Gleich zu Beginn möchte ich hier mit einem populärem Irrtum aufräumen. Der Berg auf dem die Grabkapelle steht heißt nichtRotenberg, sondern es handelt sich um den Württemberg. Rotenberg heißt lediglich die Ortschaft / der Stadtteil von Stuttgart hier oben.
"Die Liebe höret nimmer auf", diese Inschrift ziert den Eingang
zur Gruft der Grabkapelle, in der der Doppelsarkophag aus
Carrara-Marmor liegt. Dort ruht das Königspaar, die jung
verstorbene Katharina und König Wilhelm I, der im Jahre 1864
verstarb.
Königin Katharina starb im jungen Alter von 30 Jahren 1819. Die
kleine Kapelle war ehemaliger Standort der württembergischen
Stammburg (11. Jhdt.). Im Innenraum der in klassizistischer Form
gebauten Kapelle, zieren Kolossalstatuen der vier Evangelisten die
Wandnischen. Der Hofbildhauer Johann Heinrich Dannecker fertigte
sie zusammen mit seinem Schüler Theodor Wagner aus carrarischem
Marmor.
Von 1825-1899 diente die Grabkapelle als russisch-orthodoxes
Gotteshaus. Auch heute feiert die russisch-orthodoxe Gemeinde am
Pfingstmontag den Gottesdienst auf dem Württemberg. Einen
herrlichen Ausblick genießt man von der Kapelle aus auf den
idyllischen Weinort Uhlbach und das Neckartal mit dem Stuttgarter
Hafen.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Mercedes-Benz Museum
N 48° 47,316´ E 9° 14,066´
An dieser Stelle ist vor einer Plastik des 5-fachen Formel-1-Weltmeisters Juan Manuel Fangio und dessen Silberpfeil von 1954 eine Metallplatte in den Boden eingelassen.
Notiere Dir aus der letzten Zeile den 5. Buchstaben als 14. Buchstaben des Lösungswortes.
ÖPNV: Buslinie 56 Haltestelle Mercedes-Benz-Welt
Auf einem 60 000 Quadratmeter großen Areal vor dem Haupttor des DaimlerChrysler-Werks in Stuttgart-Untertürkheim ist die neue "Mercedes-Benz Welt" entstanden. Am 17. September 2003 wurde der Grundstein für das neue Mercedes-Benz Museum gelegt und im Mai 2004 fiel der Startschuss für den Neubau des Mercedes-Benz Centers Stuttgart. Rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 fand die Eröffnung der Mercedes-Benz Welt statt. Damit löste es das seit 1923 bestehende Mercedes-Benz Museum im Stammwerk Untertürkheim ab, und setzt dessen Geschichte fort.
Über 110 Jahre innovative Automobilgeschichte sind
ausgestellt. Sie sehen die ersten Automobile der Welt von Karl Benz
und Gottlieb Daimler, natürlich den ersten Mercedes und
weitere 160 ausgestellte Fahrzeuge, die den Mythos Mercedes
ausmachen. Zu sehen sind unter anderem bedeutende Rennwagen wie der
"Blitzen-Benz", mit dem Bob Burman 1911 in Daytona Beach mit 228
km/h einen sensationellen Weltrekord aufgestellt hat. Sie finden
Limousinen und Sportwagen aus den 20er und 30er Jahren. Prestige
und Leistung, Luxus und Komfort charakterisieren die Fahrzeuge aus
dieser Zeit. Beispiele sind die Kaiserwagen und die
Kompressor-Sportwagen mit dem 500 K Spezialroadster als Highlight.
Beachten Sie auch den 260 D, den ersten Serien-Diesel-Pkw der Welt
und den 170 V, den meistverkauften Mercedes-Benz der
Vorkriegszeit.
Die "Silberpfeile" schrieben auch nach dem Krieg viele glorreiche
Kapitel der Mercedes-Benz Renngeschichte. Der Mercedes-Benz 300 SL
Coupé mit seinen Flügeltüren wurde zur Legende. Auf der Basis des
Rennsportwagens von 1952 ging er 1954 in Serie. Lassen Sie sich von
Meilensteinen der Technik, zukunftweisendem Design und der
einzigartigen Geschichte der Fahrzeuge faszinieren.
Abgerundet wird das Angebot des Museums durch Restaurants und Museums-Shops.
Das Gebäude:
Die Grundstruktur des architektonisch aufregenden Museumsgebäude ähnelt einem dreiblättrigen Kleeblatt. In der Mitte der gewölbten Form entstand so ein dreieckiges Atrium, um das herum die Ausstellungsräume angeordnet sind. Die Ausstellung folgt dabei einer geschraubten Helix, die sich über alle Stockwerke zieht. Besucher starten ihren Rundgang dabei nicht im Erdgeschoss, sondern gelangen mit Aufzügen zum höchsten Punkt des Museums und laufen von dort die Wendel abwärts, wobei die Ausstellung dem Alter der Autos folgt, und der Besucher von oben nach unten die chronologische Entwicklung der Marke und des Mythos Mercedes mitverfolgt.
Die Ausstellungsfläche beträgt 16.500 m2
Das Gebäude hat eine Höhe von 47.5 m
Dank der Schraubenform sind Räume von 33 m Breite ohne tragende Säulen ermöglicht worden.
Das Atrium hat eine Höhe von 42 m.
Über 160 Fahrzeuge sind auf insgesamt 9 Ebenen ausgestellt.
Der Bau kostete 150 Mio. Euro.
1.200 Besucher können sich gleichzeitig im Museum aufhalten.
Die Eröffnung erfolgte am 19. Mai 2006 durch Ministerpräsident Günther H. Oettinger und Konzernchef Dieter Zetsche
Der Entwurf stammt von "UN Studio", einem der innovativsten europäischen Architekturbüros, das zum Beispiel bereits die Erasmus-Brücke in Rotterdam entwarf.
-
Stadion
N 48° 47,494´ E 9° 13,810´
An dieser Stelle befindet sich eine Anzahl von Telefonzellen. Wie viele Telefonzellen sind es?
1 = e
2 = z
3 = h
4 = a
5 = m
Notiere Dir den richtigen Buchstaben als 7. Buchstaben des Lösungswortes.
ÖPNV + Parkplatz: braucht man nicht; kann man zusammen mit Stage 23 + 25 erlaufen
Das Gottlieb-Daimler-Stadion, ehemals Neckarstadion, liegt im
rund 55 ha großen NeckarPark Stuttgart. Das markanteste Merkmal ist
die Stahlseilbinder-Konstruktion des Membrandaches, das die
gesamten Zuschauerplätze überspannt. Dem Fußball, der
Leichtathletik und allen anderen Veranstaltungstypen steht mit dem
Gottlieb-Daimler-Stadion eine Veranstaltungsstätte zur Verfügung,
die zu den modernsten und funktionsgerechtesten Sportanlagen
Europas zählt.
Zwischen dem 9.Juni und 9.Juli 2006 war die Landeshauptstadt
Stuttgart mit dem Gottlieb-Daimler-Stadion Austragungsort von
insgesamt 6 FIFA-Weltmeisterschaftsspielen inklusive des
unvergesslichen Spiels um Platz 3 zwischen Deutschland und
Portugal. Im Zuge der Vorbereitungen auf diese, neben den
Olympischen Spielen, größte und wichtigste Sportveranstaltung wurde
das Stadion in vielen Bereichen durch den Eigentümer, der
Landeshauptstadt Stuttgart, modernisiert.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Cannstatter Wasen
N 48° 47,592´ E 9° 13,546´
Das gesuchte Schild ist ein Straßennamenschild.
Geburtsjahr des Namensgebers = K
ÖPNV + Parkplatz: braucht man nicht; kann man zusammen mit Stage 23 + 24 erlaufen
Das Cannstatter Volksfest findet alljährlich Ende September /
Anfang Oktober auf dem Freigelände Cannstatter Wasen statt.
Im Jahr 1818 wurde es nach bedrückenden Hungerjahren als
Landwirtschaftliches Hauptfest von König Wilhelm I. seinen Bürgern
gestiftet. Im Laufe der Zeit gruppierten sich einzelne Schausteller
mit Fahrgeschäften um das Landwirtschaftliche Hauptfest herum, bis
das Cannstatter Volksfest schließlich hauptsächlich zu einer Kirmes
wurde. Mittlerweile hat es sich zum zweitgrößten deutschen
Volksfest nach dem Münchener Oktoberfest entwickelt. Jedes Jahr
werden hier u. a. riesige Bierzelte, aufwendige Fahrgeschäfte,
Mandelbrennereien, Schiessbuden und natürlich das bekannte
Riesenrad, aufgebaut.
-
Kursaal
N 48° 48,536´ E 9° 13,394´
Notiere Dir den 1. Buchstaben der 4. Zeile als 5. Buchstaben des Lösungswortes.
Parkplatz: N 48° 48,456´ E 9° 13,307´
ÖPNV: U2 Haltestelle Kursaal
Der Große Kursaal wurde von 1825 bis 1841 im Stil des Klassizismus nach Plänen von Nikolaus von Thouret vom "Brunnenverein Cannstatt" und mit Unterstützung König Wilhelms I. erbaut. Lange Zeit diente er als Badeanstalt, in der Ende des 19. Jahrhunderts sogar Königinnen und Könige kurten. 1943 brannte der Kursaal aus, 1949 wurde er wieder aufgebaut. Das schlossartige Gebäude verfügt heute über einen Brunnenhof für Trinkkuren, diverse Tagungs- und Veranstaltungsräume sowie ein Restaurant und einen Biergarten. Den Kleinen Kursaal erbaute Albert Eitel 1907 bis 1909 im Jugendstil. Von 1976 bis 1977 wurde er saniert.
© Landeshauptstadt Stuttgart
-
Daimler-Gedächtnisstätte
N 48° 48,[J*109]´ E 9° 13,[K-1431]´
Notiere Dir den 2. Buchstaben des 2. Wortes der 3. Zeile als 2. Buchstaben des Lösungswortes.
(Anm. d. Owners.: Die eigentliche Gedächtnisstätte befindet sich in einem kleinen Häuschen ca. 20 Meter hinter dem Denkmal.)
Nachdem Gottlieb Daimler mit seiner Familie 1882 in die Villa in
der Taubenheimstraße in Cannstatt gezogen war, baute er sein
Gartenhaus zur Werkstatt um. Der Raum mit Werkzeugbank und Schmiede
wurde das Refugium von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach. Hier
wollten die beiden Ingenieure ihre Vision von der individuellen
Mobilität verwirklichen: einen transportablen Universalmotor für
Fahrzeuge zu Wasser, zu Lande und in der Luft.
Sie arbeiteten Tag und Nacht unter strengster Geheimhaltung. Selbst
die Familie und die Hausangestellten wussten nicht, was im
Gartenhaus vor sich ging. Daimlers misstrauischer Gärtner holte
sogar die Polizei, weil er glaubte, im Gartenhaus befände sich eine
Falschmünzerei. Die Überraschung war groß, als die Polizei nur
Werkzeuge und Motorteile fand. Im Gartenhaus entwickelten Daimler
und Maybach 1883 den ersten schnelllaufenden Motor, 1885 entstand
hier der erste leichte, schnelllaufende Motor, die sog. "Standuhr",
der in Fahrzeuge eingebaut werden konnte. Erster Versuchsträger war
ein Zweirad, der sog. "Reitwagen", das erste Motorrad der Welt.
1886 bauten Daimler und Maybach den Motor in eine Kutsche ein,
gleichzeitig kam er auch im ersten Motorboot der Welt, der
"Neckar", zum Einsatz.
Das Gartenhaus wurde nun schnell zu eng. Im Juli 1887 bezog Daimler
ein Fabrikgebäude am Seelberg. Das Werkstatt-Ambiente, Zeichnungen,
Dokumente, Fotos und Modelle (erstes Motorboot von 1886;
Wolfertsches Luftschiff von 1888) vermitteln heute noch etwas vom
Flair dieser Jahre.
Der Final (kl. Filmdose) liegt hinter dem Gedenkstein an den oben errechneten Koordinaten der letzten Station. Im Final sind noch Anweisungen zum Loggen hinterlegt. Diese bitte im Cache lassen !!!
Wer vor lauter Sehenswürdigkeiten jetzt erst einmal etwas zur Stärkung braucht, dem sei dringendst der Biergarten bei N 48° 48,485´ E 9° 13,460´ empfohlen.
Die Texte zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten wurden mit freundlicher Genehmigung der jeweiligen Urheberrechtsinhaber verwendet.
![]() Hilfreiches
Hilfreiches
 Suche Caches im Umkreis:
alle -
suchbare -
gleiche Cacheart
Suche Caches im Umkreis:
alle -
suchbare -
gleiche Cacheart

 Download als Datei:
GPX -
LOC -
KML -
OV2 -
OVL -
TXT -
QR-Code
Download als Datei:
GPX -
LOC -
KML -
OV2 -
OVL -
TXT -
QR-Code
 Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.
![]() Logeinträge für Stuttgarter Sehenswürdigkeiten Cache
Logeinträge für Stuttgarter Sehenswürdigkeiten Cache
![]() 16x
16x
![]() 0x
0x
![]() 0x
0x
 26. April 2011
skywalker90
hat den Geocache gefunden
26. April 2011
skywalker90
hat den Geocache gefunden
Was für eine coole Idee!
Wir konnten gemütlich und ohne Probleme trotz des hohen Muggelaufkommens zur Mittagszeit loggen.
Vielen Danke für diesen besonderen Cache!
TFTC!
Grüße
Skywalker90
 15. Januar 2011
donweb
hat den Geocache gefunden
15. Januar 2011
donweb
hat den Geocache gefunden
Nach all den "Jahren" haben wir diese Mammutrunde auch mal zu Ende gebracht und die schön große Dose gefunden.
Danke sagen die donwebs
 13. Juli 2010
Cacher_Stgt
hat den Geocache gefunden
13. Juli 2010
Cacher_Stgt
hat den Geocache gefunden
Logübernahme von gc.com - keine weiteren Kommentare. Auch wenn ich den Schritt des Owners nachvollziehen kann, ist OC nicht wirklich meine Plattform. Wenn schon meine Stats bei gc durcheinander gebracht wurden, stimmen so wenigstens meine persönlichen Stats.
T4TC und Gruß,
Cacher_Stgt
 10. Juli 2010
alfi08
hat den Geocache gefunden
10. Juli 2010
alfi08
hat den Geocache gefunden
Da die Dose bei GC verschwunden ist, loggen wir nun bei OC. Haben uns vor kurzem auch hier angemeldet. Die Dose haben wir am 02.04. bei GC geloggt als Duflisa. Schön, dass der Cache hier erhalten bleibt! Dieser Cache war einer der zeitaufwändigsten die wir bisher gemacht haben, aber auch interessant und hat uns mal endlich wieder an Ecken in Stuttgart gebracht die wir noch nicht kannten oder schon ewig nicht mehr da waren.
Vielen Dank für die Dose!
Alfi08
 10. Juli 2010
Thomas & Dani
hat den Geocache gefunden
10. Juli 2010
Thomas & Dani
hat den Geocache gefunden
Irgendwann im Jahre 2009 gefunden.
Schade das dieser Cache von der Plattform GC verschwunden ist, was ich sehr bedauer. Aber ich kann den Owner verstehen.
Für diesen Multi habe ich und Casi_82 sehr viel Zeit und auch Benzin verbaucht. Aber es hatte sich gelohnt. So hatten wir mal richtig schöne Plätze gesehen und auch gefunden.
Danke an den Owner
Gruß von
Thomas&Dani







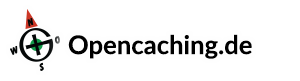

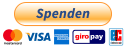







 Größe: mikro
Größe: mikro Status:
Status:  Versteckt am: 26. Juli 2005
Versteckt am: 26. Juli 2005 Listing: https://opencaching.de/OC0445
Listing: https://opencaching.de/OC0445 16 gefunden
16 gefunden 0 nicht gefunden
0 nicht gefunden 0 Bemerkungen
0 Bemerkungen 15 Beobachter
15 Beobachter 1 Ignorierer
1 Ignorierer 3841 Aufrufe
3841 Aufrufe 1
1 
