Stadtwanderweg 11 - Urbaner Gemeindebau-Wanderweg
Urbaner Stadtwanderweg
von Termite2712
 Österreich > Wien > Wien
Österreich > Wien > Wien
|
|
||||
|
|||||
| Infrastruktur |



|
| Wegpunkte |

|
| Zeitlich |

|
| Saisonbedingt |

|
| Benötigt Vorarbeit |

|
| Personen |

|
![]() Beschreibung
Beschreibung
Siehe dazu auch Info auf der Webseite der Stadt Wien.
Länge: ca. 4 km
Stationen:
- Bruno-Kreisky-Park
- Haydnhof
- Leopoldine-Glöckel-Hof
- Reumannhof / Metzleinstalerhof
- Herwegh-Hof / Julius-Popp-Hof
- Leopold-Rister-Gasse 5 (Matzleinsdorfer Hochhaus) / Theodor-Körner-Hof
- Julius-Ofner-Hof
- Zürcher-Hof
- Amalienbad
Stage 1 - Bruno-Kreisky-Park
N48 11.262 E16 20.617
Der Startpunkt für die Wanderung ist der Bruno-Kreisky-Park. Auch an einem Herbsttag ist die Grünanlage mitten in der Stadt bestens besucht.
Für diese Stadtwanderung ist der Park ein idealer Startpunkt, da er die Wiener Philosophie der grünen Stadt symbolisiert.
Rund um die Gemeindebauten gibt es viele Grünanlagen bzw. die Parks sind wichtige Bausteine im Lebensmodell des sozialen Wohnbaus.
Nach der Schleifung des Linienwalls Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Anlage ursprünglich als Sankt-Johann-Park im Bezirksteil Hundsturm errichtet.
Namensgeber war 1908 das Spital "Zu St. Johann an der Als", das von Friedrich dem Schönen gegründet wurde, der einst dieses Areal besaß.
Am 29. Juli 2005 wurde der Park anlässlich des 15. Todestages von Bruno Kreisky aufgrund der räumlichen Nähe zu dessen Geburtshaus umbenannt.
Quellen: Wikipedia, club.wien.at
Hier sehen wir u.a. auch einen Stein mit einer Gedenktafel, auf der auch der Name eines Bürgermeisters zu lesen ist.
Wir wandeln die Buchstaben vom Vornamen des Bürgermeisters in Zahlen um (A=1 ... Z=26) und bilden die Summe für die Variable A
Dann nehmen wir die Ziffernsumme der Jahreszahl, wann der Park in den heutigen Namen umbenannt wurde, für die Variable B
Stage 2 - Haydnhof
N48 11.058 E16 20.679
Geschichte
Der 1927 als Wettbewerbsprojekt ausgeschriebene Haydnhof wurde während der Februarrevolution 1934 (wie viele weitere Hofanlagen des Roten Wien) zum Schauplatz der blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Republikanischen Schutzbündlern und der christlich-sozialen Heimwehr. Von hier aus bekämpfte der Schutzbund die gegen den gegenüberliegenden Reumannhof vorgehenden Einheiten der Polizei.
Die Architektur
Der Haydnhof folgt dem Konzept der klassischen, von vier Seiten begrenzten Hofanlage. Er verfügt über einen weitläufigen Innenhof mit einem freistehenden Kindertagesheim und einer Wäscherei an der Steinbauergasse. Die sechsgeschoßige Anlage wurde 1952 durch einen Dachausbau von Adolf Wölzl erweitert, wodurch sich die Wohnungszahl von ursprünglich 304 auf 328 erhöht hat.
Ein besonderes Merkmal der Anlage sind die einzelnen, rhythmisch vor- und zurückgestuften Bauteile, deren Fassaden durch Halbloggien bzw. profilierte Gesimsbänder gegliedert sind. Straßenseitig wird die glatte, einfache Fassade durch lange, über die Ecke gezogene Gitterbalkone dominiert. Ein weiteres Charakteristikum sind die drei monumental gestalteten Eingangstore an der Arndtstraße, am Gaudenzdorfer Gürtel und an der Steinbauergasse - durch ihren klassischen Aufbau mit Halb- bzw. Rundpfeilern und Prellsteinen sowie das symmetrisch angebrachte Kugelmotiv (Rundvorlagen) erinnern sie an Toranlagen von Burgen oder Schlössern.
Der Name
Die Hofanlage ist nach dem österreichischen Komponisten Joseph Haydn (1732-1809) benannt, der auf dem nahe gelegenen "Friedhof am Hundsthurm" begraben war, ehe dieser 1926 aufgelöst und in den so genannten Haydnpark umgewidmet wurde. Eine Tafel an der Arndtstraße 1 erinnert noch heute an den "bedeutenden österreichischen Tondichter".
© Stadt Wien - Wiener Wohnen
Im Hof stehen wir nahe des Kindertagesheimes nun vor einem Kanaldeckel, der in der oberen Zeile die Herstellerfirma beschreibt ( _ _ _ _ _ _ _ & _ _ _ _ _ _ _ _ )
Wir wandeln die Buchstaben vom ersten Namen der Firma (vor dem "&") in Zahlen um (A=1 ... Z=26) und bilden die Summe für die Variable C
Die Anzahl der Wohnungen, für die der Haydnhof ursprünglich konzipiert wurde ist die Variable D
Das Geburtsjahr des Namensgebers ist die Variable E
Stage 3 - Leopoldine-Glöckel-Hof
N48 11.017 E16 20.725
Geschichte
Während des Bürgerkrieges fanden in den großen Gemeindebauten der Umgebung schwere Kämpfe statt, auch die Wohnhausanlage von Josef Frank war im Februar 1934 Schauplatz dieser Auseinandersetzungen. Den Namen "Leopoldine-Glöckel-Hof" erhielt der Gemeindebau erst am 12. September 1949, die feierliche Benennung nahm der Wiener Bürgermeister Theodor Körner vor. In den 1950er-Jahren erfolgte der Ausbau des Dachgeschoßes.
Die Architektur
Der "Leopoldine-Glöckel-Hof" des Wiener Architekten Josef Frank liegt an der so genannten "Ringstraße des Proletariats" und ist als geschlossene Blockrandbebauung konzipiert. Anhand eines raffinierten Farbkonzepts wird die Monotonie langer Straßen- und Hoffronten vermieden, vielmehr scheint sich der fünfgeschoßige Bau in eine abwechslungsreiche Abfolge unterschiedlich gestalteter Einzelhäuser aufzulösen. Die glatten Fassaden sind in verschiedenen hellen Pastellfarben gehalten und werden durch einen Wechsel unterschiedlich großer Fenster
und weit vorspringender Einzelbalkone bestimmt. Bis auf die weißen Farbumrahmungen der Fassadenöffnungen wird auf jede Form von Dekoration verzichtet, trotzdem zählt der Bau zu den spannungsvollsten und bestechendsten Wohnhausanlagen der 1930er-Jahre.
Der Name
Die Pädagogin und Politikerin Leopoldine Glöckel wurde am 12.11.1871 in Wien geboren. Die Ehefrau des Schulreformers Otto Glöckel war Mitglied verschiedener Frauenorganisationen wie etwa des "Allgemeinen Österreichischen Frauenvereins" und trat später der Sozialdemokratischen Partei Österreichs bei. Sie gehörte ab 1919 dem Wiener Gemeinderat und in Folge dem Landtag an und schrieb zahlreiche Artikel in Österreichischen Zeitschriften (z.B. "Arbeiter-Zeitung"). Während des Bürgerkriegs wurde die sozialdemokratische Politikerin vom 12. Februar bis 30. März 1934 in Polizeihaft genommen. Sie starb am 21.5.1937. Eine Tafel im Eingangsbereich erinnert an die Namensgeberin des Hofes.
© Stadt Wien - Wiener Wohnen
Gleich nach dem Eingang sehen wir an der Hauswand eine Tafel mit dem Piktogramm eines Hundes und einem 3-zeiligem Text darunter (siehe dazu auch Spoilerbild)
Wir wandeln die Buchstaben des ersten Wortes in der 3. Zeile dieser Tafel in Zahlen um (A=1 ... Z=26) und bilden die Summe für die Variable F
Das Geburtsjahr der Namensgeberin der Anlage ist die Variable G
Das Jahr, in dem der Leopoldine-Glöckel-Hof seinen jetzigen Namen erhielt, ist die Variable H
Stage 4 - Reumannhof / Metzleinstalerhof
N48 10.965 E16 20.862
Reumannhof
Geschichte
Der Architekt Hubert Gessner versuchte mit dem 460 Wohnungen und 30 Geschäftslokale umfassenden Reumann-Hof ein Symbol für das neue Wien zu schaffen. In den frühen 20er Jahren war Grundsteinlegung, 1926 wurde die Eröffnung des Reumann-Hofes gefeiert. Das erste fertig gestellte Gebäude des Wiener sozialen Wohnbaues konnte der Bevölkerung präsentiert werden. Am Beginn des Bürgerkrieges im Februar 1934 war der Reumann-Hof Hauptstützpunkt des Republikanischen Schutzbundes. Es kam zu Kämpfen und zu einer Besetzung der Anlage durch Polizeieinheiten. Im 2. Weltkrieg fielen Bomben auf den Reumannhof.
Die Architektur
Der Reumann-Hof präsentiert sich als monumentale Wohnhausanlage mit überhöhtem Mitteltrakt und harmonisch anschließenden Seitentrakten. Die Architektur entspricht dem Grundgedanken Otto Wagners (1841-1918, Architekt und Kunsttheoretiker) von einer großstädtischen und monumentalen Bauweise. Otto Wagner war Lehrer vieler Architekten, die den Wiener Sozialbau in der Zwischenkriegszeit gestalteten, und beeinflusste daher auch deren Bauweise. Herzstück der Wohnbauanlage ist der "Ehrenhof" mit Wasserbecken. Die Wasserfläche spiegelt wie bei einer Schlossanlage den Mitteltrakt wider und lässt ihn dadurch größer erscheinen. Der "Ehrenhof" ist von Arkaden, Laubengängen und Pavillons umgeben.
Die Fassade zeigt dreieckige Erker, die ihre Wurzeln im tschechischen und slowakischen Kubismus haben. Die verschiedenen Fensterformen ergeben eine interessante Wirkung nach außen und nach innen. Die Gestaltung von abgerundeten Dachstrukturen weist auf französischen Einfluss hin.
Gittertore, Geländer, Zäune und Lampen sind in Stil und Form einheitlich und in einem satten Rot gehalten. Dieselben Stilelemente und Farben finden sich an der Fassade, auf den Gehwegen, in den Majolikaplastiken und in den Elementen der Stiegenhäuser wieder. Die schwarzen Handläufe der Stiegengeländer sind mit Goldknöpfen versehen und harmonieren mit dem schwarz-weißen Steinboden und den goldenen Türknöpfen und Namensschildern.
Der Reumann-Hof kann als Gesamtkunstwerk aus Architektur, Malerei und Plastik im Sinne Otto Pächts (1902-1988, Kunsthistoriker) gesehen werden.
... und die Kunst
Zahlreiche Majolikatafeln (Keramiken) schmücken die Torbögen der Wohnhausanlage. Sie fügen sich in Farbe und Form dem Gesamtbauwerk ein und stellen verschiedene Handwerksberufe symbolhaft dar.
Ein Beispiel für die ursprünglich zahlreich geplanten Steinplastiken, deren Anzahl aus Kostengründen reduziert werden musste, zeigt am Eingang zum Kindergarten "spielende Kinder".
Der Name
Jakob Reumann (1853-1925) wurde 1919 erster sozialdemokratischer Bürgermeister Wiens. Er kann als Begründer des Wiener sozialen Wohnbaues gesehen werden. Er novellierte die Bauordnung entsprechend, unter seiner Amtsführung wurde 1923 das erste große Wohnbauprogramm beschlossen, das den Bau von 25.000 Gemeindewohnungen innerhalb von fünf Jahren vorsah.
© Stadt Wien - Wiener Wohnen
Metzleinsthalerhof
Geschichte
Bereits im Ersten Weltkrieg begann Robert Kalesa mit der Errichtung des Metzleinstalerhofes. Wegen Geldmangels musste das Bauvorhaben unterbrochen werden. Im Jahre 1918 betraute die Stadt Wien den Architekten Hubert Gessner mit der Fertigstellung des ersten Bauteiles und der Planung eines zweiten. 1925 fand die Eröffnung der Wohnhausanlage statt. Der Metzleinstalerhof war ein Beispiel für den Übergang vom "eigennützigen" zum sozialen Wohnbau - es finden sich bereits Sozialeinrichtungen wie Badeanstalt, Wäscherei, Bibliothek und Kindergarten. Im Zweiten Weltkrieg trug die Wohnhausanlage kaum Schäden davon.
Die Architektur
Der Metzleinstalerhof im 5. Wiener Gemeindebezirk präsentiert sich als Randverbauung mit einem großen rechteckigen Innenhof. Die Stiegen sind vom Hof her begehbar. Diese Form findet sich schon im barocken Heiligenkreuzerhof und im Schottenhof aus dem Biedermeier. Gliederungselemente für die Wohnhäuser sind Balkone, Loggien und Erker. Auffallend sind die häufig verwendeten Kontraste zwischen eckigen und runden Formen. Türme und Dachaufbauten wirken markant.
Im Bereich des Innenhofes sind der Fassade turmartige Gebäudeteile vorgesetzt, wodurch er eher verwinkelt wirkt. Offene Durchgänge verbinden den Hof mit der belebten Straße. Er wird als Erholungs-, Sport- und Grünraum genutzt und dient der Kommunikation.
Die Fassaden des ersten Bauteiles sind in Gelb gehalten, die des zweiten Teiles in Hellgrau. Die Elemente beider Architekten verbinden sich: Hubert Gessner setzt in seiner Fassadengliederung die Gesimse von Robert Kalesa fort und variiert sie. Die Außenfassaden sind expressiv gefaltet. Verschiedene Fensterformen sorgen für zusätzliche Spannung. Die Fassade Richtung Siebenbrunnengasse springt zurück und macht einer Terrasse Platz. An der Seite zur Johannagasse und Fendigasse springen die Erker in Form von schmalen Türmchen vor. Die Fassaden des Hofes sind schlicht, sie zeigen halbrunde Balkone und Loggien.
... und die Kunst
Die von Kalesa in Putz ausgeführten Ornamente im Bereich der Frontseiten erfahren durch Gessner eine Erweiterung und Gestaltung in Form von Majolika-Rosetten, Ranken- und Füllhornmotiven. Die farblich bunt gestalteten Majolikaverkleidungen schmücken die Außenfassaden. Besonders farbenfroh sind die Dekorationen an der Seite Richtung Siebenbrunnengasse. Gessner verwendet auch Putzritzen als Schmuck. Der Innenhof zeigt keine Majolikaplastiken.
Der Name
Metzleinstal ist ein Flurname, der bereits im Mittelalter dokumentiert ist und aus dem sich später der Name "Matzleinsdorf" entwickelte.
© Stadt Wien - Wiener Wohnen
Beim Wegpunkt befinden wir uns im Reumannhof vor einem Durchgang mit einer imposanten Bautafel.
Oben rechts neben dieser Bautafel befindet sich ein Wappen von Wien und eine Jahreszahl. Die Ziffernsumme dieser Jahreszahl ist die Variable I
Das Jahr, in dem der Namensgeber des Reumannhofes der erste sozialdemokratische Bürgermeister wurde, ist die Variable J
Das Jahr, in dem der Metzleinsthalerhof eröffnet wurde, ist die Variable K
Stage 5 - Herwegh-Hof / Julius-Popp-Hof
N48 10.852 E16 21.029
Herwegh-Hof
Geschichte
Der Herwegh-Hof wurde in den Jahren 1926/27 nach den Plänen von Heinrich Schmid und Hermann Aichinger errichtet. Mit dem Julius-Popp-Hof und dem Matteottihof bildet er eine Einheit, die dem Betrachter auf den ersten Blick als monumentale Hofanlage erscheint. Damit wurde auch dem übergeordneten Baukonzept der Stadt Wien Rechnung getragen.
Die Architektur
Der Herwegh-Hof weist eine einfache, aber klare Gartenhofgestaltung mit Foren, Treppen und Terrassen auf, die durch die strenge Mittelachse einen fast schlossartigen Charakter bekommt und an barocke Gartenarchitektur erinnert. Zur Siebenbrunnenfeldgasse sowie zur Fendigasse ist der Block relativ ruhig gestaltet. Zum Gürtel hin sind die Fassaden um eine Symmetrieachse angelegt. Ein durch Arkaden aufgelöster Mittelrisalit wurde vor die Baulinie geschoben, um für die Gartenhöfe eine größere Tiefe zu ermöglichen. Der Herwegh-Hof spiegelt vom Gürtel aus seinen "Zwillingshof", den Julius-Popp-Hof.
... und die Kunst
Im Eingangsbereich des Hofes befinden sich eine Gedenktafel und ein Medaillon des Dichters Georg Herwegh. Zwischen dem Julius-Popp-Hof und dem Herwegh-Hof liegt ein Brunnen, auf dessen Schale Sternzeichen dargestellt sind und in dessen Mitte eine Bärin mit ihrem Jungen auf einer Säule steht. Der Brunnen wurde im Jahr 1928 von Hanna Gärtner geschaffen.
Der Name
Der politische Lyriker und deutsche Freiheitsdichter Georg Herwegh (1817-1875), ein Freund Heinrich Heines und Karl Marx’, war mit seinen fortschrittlichen Werken maßgeblich an der Revolution 1848 beteiligt und musste wegen seines politischen Engagements viele Jahre ins französische und Schweizer Exil.
© Stadt Wien - Wiener Wohnen
Julius-Popp-Hof
Geschichte
Der Julius-Popp-Hof wurde in den Jahren 1925/26 nach den Plänen von Heinrich Schmid und Hermann Aichinger errichtet. Mit dem Herwegh-Hof und dem Matteottihof bildet er eine Einheit, die dem Betrachter auf den ersten Blick als monumentale Hofanlage erscheint. Damit wurde auch dem übergeordneten Baukonzept der Stadt Wien Rechnung getragen.
Die Architektur
Mit den Merkmalen des Eckpylonen und des arkadendurchzogenen Mittelrisaliten ist die Gestaltung des Hofes dem "Zwillingsbau" Herwegh-Hof noch sehr ähnlich. Mit der Entfernung zur geordneten Mittelachse zwischen den beiden Höfen ändert sich dies jedoch. Der Südtrakt erstreckt sich entlang des Gürtels Richtung Osten in die Breite, der der Einsiedlergasse zugewandte Osttrakt des Hofes fällt durch seine interessant gestaffelte Anordnung auf. Im Inneren des abgetreppten Hofes befindet sich ein zungenförmiger Bautrakt, der eine vielfältige Gliederung, Eckloggien sowie dreieckige Erker
aufweist.
... und die Kunst
Im Eingangsbereich des Hofes befindet sich eine Gedenktafel des Namensgebers Julius Popp. Zwischen dem Julius-Popp-Hof und dem Herwegh-Hof liegt ein Brunnen, auf dessen Schale Sternzeichen dargestellt sind und in dessen Mitte eine Bärin mit ihrem Jungen auf einer Säule steht. Der Brunnen wurde im Jahr 1928 von Hanna Gärtner geschaffen.
Der Name
Julius Popp (1849-1902) war ein enger Freund und Mitarbeiter Viktor Adlers. Der gelernte Schuhmacher war als Kassier der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und als Administrator der Arbeiterzeitung tätig. Seine Gattin Adelheid (geb. Dworak) zählt zu den bedeutendsten Frauen in der Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung.
© Stadt Wien - Wiener Wohnen
Wir betrachten im Herwegh-Hof bei den Koordinaten die Bautafel und bilden aus allen Ziffern in der 2. Zeile (!) die Summe für die Variable L
Das Geburtsjahr des Namensgebers des Herwegh-Hofes ist die Variable M
Wir wandeln den Vornamen der Gattin des Namensgebers des Julius-Popp-Hofes in Zahlen um (A=1 ... Z=26) und bilden die Summe für die Variable N
Stage 6 - Leopold-Rister-Gasse 5 (Matzleinsdorfer Hochhaus) / Theodor-Körner-Hof
N48 10.923 E16 21.422
Geschichte
Im Jahre 1951 erfolgte der Spatenstich für den Theodor-Körner-Hof. Früher war auf dem Baugelände der Heu- und Strohmarkt abgehalten worden. Im Zentrum der Anlage entstand ab 1954 ein 20-stöckiges Hochhaus (Wohnhochhaus am Matzleinsdofer Platz).
Die Architektur
Der Theodor-Körner-Hof ist als gartenstadtartige Wohnhausanlage angelegt. Auf einer Gesamtfläche von 30.000 m² gruppieren sich 14 Wohnblöcke um Höfe und Grünflächen. Die vier- bis siebengeschoßigen Wohnblöcke werden von Straßen umrahmt. Auf den ersten Blick unterscheiden sich die einzelnen Wohnblöcke nur durch ihre unterschiedlichen Fassadenfarben und die verschiedenfärbigen Balkone voneinander. Bei genauerer Betrachtung findet man an Fensterrahmen, Stiegenaufgängen, vorspringenden Gebäudeteilen und Balkonen individuelle Details. Die Anordnung der Häuser folgt den Gegebenheiten des Geländes. Gegeneinander geschobene Blöcke lassen interessante Hauseingänge und Durchgänge entstehen. Die Stiegen 9 bis 17 bilden einen massiven Block, der nur durch zwei mächtige Risalite aufgelockert wird. Inmitten der Wohnhausanlage stehen zwei Wohnblöcke als losgelöste Bauteile.
An den Fassaden finden sich insgesamt 350 Balkone, die passend zu den jeweiligen Fassadenfarben in Rot, Grün und Blau gehalten sind. Die Balkone sind unterschiedlich gestaltet (rechteckig, trapezförmig, Doppelbalkone). Modern wirken einzelne vor die Fassade gestellte Balkontürme. Aufzüge sind in die Stiegenhäuser eingebaut oder stehen direkt vor der Fassade. Die Wohnanlage verfügt über Geschäfte, Ordinationen, Kinderwagen- und Fahrradräume. Für Künstler sind einige Atelierwohnungen vorgesehen.
... und die Kunst
Wander Bertoni schuf das als Supraporte dienende Kunsteinrelief "Abstrakte Flächenteilung" (1956/57), Karl Sterrer das Mosaikwandbild "Zwei Pferde". Der "Figurale Fries" über der Straßendurchfahrt stammt von Fritz Wotruba (1953-1955). Weiters befinden sich in der Anlage die Bronzeplastik "Freunde" von Siegfried Charoux (1955/57), die Kalksteinplastiken "Zwei sitzende weibliche Figuren" von Margarete Hanusch (über einem Tor, 1953) und die "Kinderdoppelrutsche" aus Beton von Josef Seebacher (1955). Die nur noch zum Teil erhalten Hauszeichen und Rahmungen an den Eingängen stammen von Mea Bratusch, Adolf Kloska und Franz Pixner. Der "Gedenkstein für Theodor Körner" wurde von Ferdinand Welz gestaltet.
Der Name
Theodor Körner (1873-1957) war sozialdemokratischer Politiker. Er war Mitglied des Republikanischen Schutzbundes und riet im Bürgerkrieg 1934 von einem gewaltsamen Widerstand gegen die austrofaschistische Diktatur ab. Körner war von 1945 bis 1951 Bürgermeister von Wien und von 1951 bis 1957 österreichischer Bundespräsident. In seiner Amtszeit förderte er die Zusammenarbeit der Großparteien.
© Stadt Wien - Wiener Wohnen
An den Koordinaten der Stage betrachten wir die Büste des dort genannten Wohltäters. Die Differenz der beiden darauf ersichtlichen Jahreszahlen in der letzten Zeile der Inschrift ist die Variable O
Wir addieren die Anzahl der Wohnblöcke des Theodor-Körner-Hofes zu der Anzahl der Stockwerke des Matzleinsdorfer Hochhauses für die Variable P
Dann wandeln wir den Vornamen der Künstlerin, die die Plastik "Zwei sitzende weibliche Figuren" schuf, in Zahlen um (A=1 ... Z=26) und bilden die Summe für die Variable Q
Stage 7- Julius-Ofner-Hof
N48 10.975 E16 21.797
Geschichte
Die Wohnhausanlage erstreckt sich entlang des Gürtels, welcher anstelle des bereits ab 1704 errichteten Linienwalls angelegt wurde. Dabei handelte es sich um einen Erdwall mit vorgelagertem Graben, der die Stadt vor feindlichen Angriffen schützen sollte. Nach der Eingemeindung der Vororte wurde der Linienwall ab 1894 demoliert und mit dem Bau der Stadtbahn (heute Linie U6) begonnen.
Die Architektur
Die Anlage des Julius-Ofner-Hofes bildet mit ihrem U-förmigen Grundriss einen großen Innenhof, von dem aus die Wohnungen erschlossen werden. Die zum Gürtel gewandte Straßenfassade ist symmetrisch gegliedert. In der Mitte befindet sich der Eingang, der durch eine großzügige Klinkerverkleidung besonders hervorgehoben wird und durch den man in den Hof gelangt. Die horizontale Gliederung erfolgt durch die Balkone und die optisch abgehobene, zweigeschoßige Sockelzone. Die beiden leicht hervortretenden Stiegenhäuser bilden gemeinsam mit den turmartig überhöhten Eckteilen die vertikale Komponente.
Der Name
Julius Ofner (1845-1924), ein ausgebildeter Jurist, wurde 1896 in den NÖ Landtag gewählt und gehörte von 1901 bis 1918 dem Reichsrat an. 1919 war er Mitbegründer der "Demokratischen Partei". Ofner leistete vor allem in den Bereichen des Arbeits- und Strafrechts einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung des österreichischen Rechts.
© Stadt Wien - Wiener Wohnen
An den Koordinaten der Stage befinden sich links neben dem Stiegeneingang zwei rot umrandete Tafeln. Auf der oberen der Tafeln ist "Brandrauchentlüftung" zu lesen.
Wir wandeln aber die Buchstaben des zweiten Wortes auf der unteren Tafel in Zahlen um (A=1 ... Z=26) und bilden die Summe für die Variable R
Das Geburtsjahr vom Namensgeber der Anlage ist die Variable S
Das Jahr, in dem er in den niederösterreichischen Landtag gewählt wurde,. ist die Variable T
Stage 8 - Zürcher-Hof
N48 10.665 E16 22.502
Geschichte
Die heute unter Denkmalschutz stehende Wohnhausanlage wurde in den Jahren 1928 bis 1931 von Emil Hoppe und Otto Schönthal für ursprünglich 233 Wohneinheiten konzipiert. Das Haus war damals auch als "GÖC-Hof" bekannt, da hier 1905 das erste Warenhaus der "Großeinkaufsgesellschaft für österreichische Consumvereine" unter Benno Karpeles (Funktionär der "Vorwärts"), eingerichtet wurde. 1930 befanden sich bereits rund 20 Warenhäuser, darunter auch jenes der "Staatsangestellten-Fürsorge-Anstalt" (Stafa) in der Marhiahilfer Straße, im Eigentum der Gesellschaft. Der Zürcher Hof, benannt nach der Stadt Zürich als Dank für die Schweizer Hilfe nach dem Zweiten Weltkrieg, war aber auch Sitz eines Kino- bzw. Vortragssaales und anderer Gemeinschaftseinrichtungen in einer eigenen Geschäftszone, die zum Teil heute - wenngleich in anderer Form - weiter besteht (unter anderem "Gesundheits- und Sozialzentrum Favoriten" sowie "Fonds Soziales Wien"). 2006 wurde die Anlage umfangreich saniert.
Die Architektur
Der Zürcher Hof ist eine der eindrucksvollsten Wohnhausanlagen Favoritens, die in der Zeit des "roten Wohnbauprogramms" entstanden sind. Die sechsgeschoßige, elf Stiegen umfassende Anlage wurde als axialsymmetrische Blockrandbebauung um einen geräumigen Innenhof konzipiert, an der Laxenburger Straße wird diese durch einen monumentalen Torbau mit einem darüberliegenden keramischen "Fries der Arbeit" von Siegfried Charoux unterbrochen, sodass der Eindruck zwei solitärer Blocks entsteht, die sich jedoch durch die durchgängige Geschäftszone und den Sockel, in den der Torbau eingebunden ist, zu einer Einheit zusammenfügen. Die symmetrischen, breitgezogenen Balkongruppen mit geriffelter Bänderung unterstreichen diese Wirkung noch. Überhaupt wird die horizontale Gliederung der Straßen- und Hoffronten durch stark profilierte Gesimse und gemauerte Brüstungen der Balkone und Loggien besonders betont. Der geräumige Innenhof ist durch die Erschließungswege dreigeteilt; die 223 Wohnungen werden hofseitig durch die ebenso imposanten wie exponierten, über die Dächer gezogenen Stiegenhauskerne erschlossen, die der Anlage nicht zuletzt etwas Mächtiges und Bedrohliches verleihen.
... und die Kunst
Über dem mächtigen Torbau in der Laxenburger Straße befindet sich das von Siegfried Charoux stammende "Fries der Arbeit" (1930), auf dessen linker Seite sich die bäuerliche, auf der rechten die städtisch-proletarische Arbeitswelt abzeichnet. Charoux (1896 - 1967), der 1919 Bildhauerei studierte, aber auch unter dem Pseudonym "Chat roux" als Karikaturist für die Arbeiter-Zeitung tätig war, emigrierte 1935 nach England. Von Charoux stammt unter anderem auch das neue Lessing-Denkmal (1962 - 1965), das jedoch erst 1981 am Judenplatz aufgestellt wurde.
Der Name
Die Anlage wurde am 8. 7. 1949 als Dank für die umfassende Schweizer Hilfe nach dem Zweiten Weltkrieg nach der Stadt Zürich benannt.
© Stadt Wien - Wiener Wohnen
Wir befinden uns nun am Tor in der Columbusgasse und betrachten die beiden Gegensprechanlagen an der rechten Seite genauer.
Die Anzahl der grünen Tasten auf der Gegensprechanlage für die Stiegen 1 - 5 ist die Variable U
Die Differenz der Anzahl der ursprünglich konzipierten Wohneinheiten zur Anzahl der heutigen Wohnungen ist die Variable V
Das Geburtsjahr des Künstlers, der das "Fries der Arbeit" schuf, ist die Variable W
Stage 9 - Amalienbad
N48 10.435 E16 22.768
Das Amalienbad wurde in den Jahren 1923 bis 1926 von der Wiener Stadtverwaltung nach Plänen der Architekten Karl Schmalhofer und Otto Nadel erbaut und sei zu dieser Zeit „die größte und modernste Badeanstalt Mitteleuropas“ (AZ, 1926) gewesen. Die großen Skulpturen an der Fassade schuf Karl Stemolak, die keramische Innenausstattung stammt aus den kunstkeramischen Werkstätten der Brüder Schwadron. In architektonischer Hinsicht war das Bad an die Grundrisse römischer Thermen angelehnt. Die elegante Innenausstattung erfolgte im Art-Déco-Stil. Die Schwimmhalle besaß neben Tribünen auch ein bewegliches Glasdach, das man in nur drei Minuten öffnen konnte. Neben dem Schwimmbecken umfasste die Anlage auch Heilbäder und bot für insgesamt rund 1.300 Besucher Platz.
Noch während der Bauzeit des Bades wurde der bisherige Bürgerplatz davor und nur wenige Wochen nach dem Tod von Jakob Reumann im Juli 1925, dem „ersten Arbeiterbürgermeister von Wien“, nach ihm umbenannt, wie die Arbeiter-Zeitung (AZ), das Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschösterreichs, nach der Eröffnung des Amalienbades im Juli 1926 verkündete: „Früher, da hießen in Favoriten die Plätze nach den Mitgliedern der Familie Habsburg, […]. Jetzt gibt es einen Viktor Adlerplatz, einen Reumannplatz und ein Amalienbad, das nicht nach einer Erzherzogin heißt, sondern nach einer Arbeiterin“, namentlich nach der im Jahr 1924 verstorbenen Favoritnerin und sozialdemokratischen Wiener Gemeinderätin Amalie Pölzer.
Im Zweiten Weltkrieg wurde das Bad schwer beschädigt und nur noch in einer Sparvariante wieder aufgebaut. In den Jahren 1979 bis 1986 fand eine umfangreiche Generalsanierung statt.
Das Amalienbad ist in die Bereiche Schwimmhalle, Sauna, Brausebad und Sonnenbad untergliedert. Die Schwimmhalle umfasst ein Sport- und Bahnen-Schwimmbecken im Ausmaß von 33,3 × 12,5 Meter und einer Tiefe von 1,25 bis 4,85 Meter sowie ein Kinderbecken. Der Sprungturm ist ausschließlich nur Schulen und Vereinen zugänglich. Im Saunabereich stehen die gängigen Saunaangebote inklusive Whirlpool und Infrarotkabine zur Verfügung. Im weiteren Angebot finden sich ein vereinfachter Spa-Bereich sowie die Gastronomie mit Restaurant und Saunabuffet.
Darüber hinaus sind in dem Gebäudekomplex ein Ambulatorium für physikalische Therapie sowie die Magistratsabteilung 44, „Wiener Bäder“, angesiedelt.
Quelle: Wikipedia
An der Koordinaten der Stage sehen wir wieder eine Gegensprechanlage.
Wir addieren die Löcher des Lautsprechers zu denen des Mikrofons (siehe Spoilerbild) für die Variable X
Zuletzt nehmen das Jahr der Eröffnung für die Variable Y
Jetzt können wir uns im Park am Reumannplatz ein ruhiges Plätzchen suchen und die finalen Koordinaten ermitteln.
Final:
N48° (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y-9052)/1000
E016° (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+3107)/1000
Die Variablen könnt ihr im Multitschäcka überprüfen.
Version 8.0
![]() Verschlüsselter Hinweis
Verschlüsselter Hinweis
![]() Entschlüsseln
Entschlüsseln
vz Zhygvgfpunrpxn
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
![]() Bilder
Bilder
![]() Hilfreiches
Hilfreiches
 Suche Caches im Umkreis:
alle -
suchbare -
gleiche Cacheart
Suche Caches im Umkreis:
alle -
suchbare -
gleiche Cacheart

 Download als Datei:
GPX -
LOC -
KML -
OV2 -
OVL -
TXT -
QR-Code
Download als Datei:
GPX -
LOC -
KML -
OV2 -
OVL -
TXT -
QR-Code
 Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.
![]() Logeinträge für Stadtwanderweg 11 - Urbaner Gemeindebau-Wanderweg
Logeinträge für Stadtwanderweg 11 - Urbaner Gemeindebau-Wanderweg
![]() 4x
4x
![]() 0x
0x
![]() 0x
0x
![]() 4x
4x
 14. August 2025
Termite2712
hat den Geocache gewartet
14. August 2025
Termite2712
hat den Geocache gewartet
Kleiner Umbau ....
 24. April 2022, 16:38
Gavriel
hat den Geocache gefunden
24. April 2022, 16:38
Gavriel
hat den Geocache gefunden
Früher hat man sich noch mehr angestrengt, heute sieht alles gleich aus.
Thx
Gavriel
 07. Februar 2022
Termite2712
hat den Geocache gewartet
07. Februar 2022
Termite2712
hat den Geocache gewartet
Alles wieder o.k.
 02. Februar 2022
Termite2712
hat den Geocache deaktiviert
02. Februar 2022
Termite2712
hat den Geocache deaktiviert
kurze Pause
 14. Juni 2021
Termite2712
hat den Geocache gewartet
14. Juni 2021
Termite2712
hat den Geocache gewartet
Änderung bei Stage 8
zuletzt geändert am 15. Juni 2021







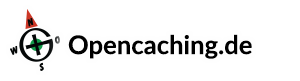

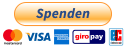







 Größe: mikro
Größe: mikro Status: kann gesucht werden
Status: kann gesucht werden
 Versteckt am: 21. Dezember 2020
Versteckt am: 21. Dezember 2020 Listing: https://opencaching.de/OC1671C
Listing: https://opencaching.de/OC1671C Auch gelistet auf:
Auch gelistet auf:  4 gefunden
4 gefunden 0 nicht gefunden
0 nicht gefunden 0 Bemerkungen
0 Bemerkungen 4 Wartungslogs
4 Wartungslogs 1 Beobachter
1 Beobachter 0 Ignorierer
0 Ignorierer 128 Aufrufe
128 Aufrufe 0 Logbilder
0 Logbilder
